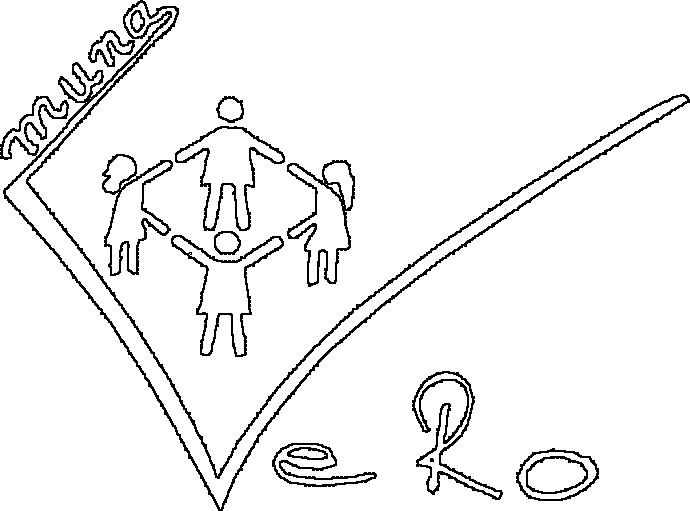
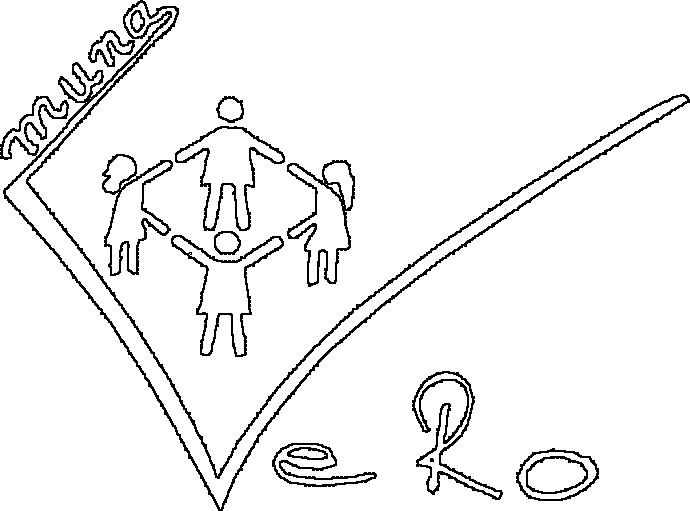
Verständigung Rodgau e.V.
Wiesbadener Str. 83, 63110 Rodgau - Nieder- Roden
Tel: (06106) - 73 33 25 / Fax: 88 65 60
Zeitung No.
5 September 1999
zum
Zeitungs-Anfang
zurück zu ZEITUNG
Inhalt:
Besuch der Ausstellung: „Der
Nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma"
in Heidelberg.
Menschenrechte „im Kleinen" :
Kinderkarawane in Rodgau
Kinderleichte Fragen,
schwer zu beantworten
„munaVeRo Wochenende"
Nach dem Krieg im Kosovo
...
„Die Sprache der Menschen" (Gedicht)
Muna und Over ... und
die Zigeuner
Mitgliederversammlung
am 8. September
Erde, Ortsteil Rodgau: Lokale
Agenda 21
- munaVeRo und die Agenda
- jeder redet von der Agenda, was
ist der Hintergrund?
Fünf Jahre Jugendaustausch
mit Polen
Minderheiten: Deutsche
in Polen, Polen in Deutschland
Impressum
Besuch der
Ausstellung: Der nationalsozialistische Völkermord an den
Sinti und Roma.
zurück
zum Inhalt
Am Anfang der Sommerferien haben
wir in Heidelberg, im Dokumentationszentrum deutscher Sinti und
Roma, die Ausstellung über deren Verfolgung durch die Nationalsozialisten
besucht. Eine kleine (aber feine!) Schar Daheimgebliebener folgte
dem Aufruf und fuhr am 6.7 mit.
Nur noch eine kleine Minderheit
der Sinti und Roma zieht mit dem Wohnwagen umher. Dennoch prägt
diese Minderheit hauptsächlich unser Bild von den „Zigeunern",
wie sie vielfach noch genannt werden.
Dabei sind deutsche Sinti und Roma seit Jahrhunderten hier beheimatet
und verstehen sich in der Mehrheit als ganz normale Deutsche,
die inzwischen in allen gesellschaftlichen Bereichen und in allen
Berufen integriert sind.
Das galt auch weitgehend schon vor
der nationalsozialistischen Machtergreifung.
Viele Sinti und Roma lebten ortsgebunden, übten bürgerliche
Berufe aus, dienten in der Armee und auch in der Marine.
Die meisten deutschen Sinti und Roma waren Christen.
Dennoch gab es weit verbreitet die noch heute erhaltenen Vorurteile
über Zigeuner als fahrendes „Gesindel", das bettelt,
stiehlt und arbeitsscheu ist.
„Zigeuner" waren
zwar den Nationalsozialisten verdächtig, sie wurden aber
nicht so öffentlich und vordringlich zum Volksfeind erklärt,
wie die Juden. Deshalb wollte man nach dem Krieg zunächst
nicht wahrhaben, daß es überhaupt eine systematische
Verfolgung gegeben hatte. Viele überlebende Opfer mußten
jahrelang um die Anerkennung und Wiedergutmachung kämpfen.
Rassenideologen der Nationalsozialisten
erklärten die Zigeuner für minderwertig.
Ärzte und Mitarbeiter der NS-Gesundheitsbehörden, sogenannte
„Rassehygieniker", versuchten durch systematische und
zwangsweise Vermessung aller möglichen Körpermerkmale
Eigenheiten einer „zigeunerischen Rasse" als sicheres
Unterscheidungsmerkmal vom „arisch/germanischen" Menschen
zu finden.
Sie lieferten die scheinbar wissenschaftliche Begründung
und bereiteten den Weg für die konsequente Verfolgung.
(Die Namen Robert Ritter und Eva Justin haben hierdurch eine traurige
Berühmtheit erlangt und mit ihnen die Stadt Frankfurt - zuletzt
im vergangenen Jahr durch eine verweigerte Gedenktafel am Gesundheitsamt,
wo Ritter und Justin auch nach dem Krieg noch viele Jahre unbehelligt
gearbeitet haben.)
Mit dem Erlass von Zigeunergesetzen,
der systematischen Beobachtung und Erfassung durch die Polizei,
der Verordnung von Aufenthaltsbeschränkungen und letztlich
der Deportierung begann eher nebenbei und wenig beachtet die Verfolgung
und Ermordung tausender Sinti und Roma in Konzentrations- und
Vernichtungslagern.
In Heidelberg dokumentiert eine Ausstellung diese Entwicklung in allen Stadien sehr eindringlich und nachvollziehbar mit Dokumenten wie Erlassen des Innenministeriums, Urteilen, Zeitungsberichten, Schriftwechsel und Tagesbefehlen von SS und Kriminalpolizei, Bildern und Kurzbiographien der Opfer und Videos mit Zeitzeugenberichten.
Beeindruckend und bedrückend die Ausstellung - sehr engagiert und nicht wissenschaftlich kalt und nüchtern die Führung durch Frau Anita A., die als Sintezza einen ganz persönlichen Bezug zu den Bildern hat: für sie werden nicht nur irgendwelche anonymen Opfer beschrieben, die Ausstellung dokumentiert auch Schicksale einiger Verwandter.
Ich frage sie, ob es ihr als Betroffener nicht schwerfällt, durch diese Ausstellung zu führen.
Sie hat gelernt, anfänglich
aufkommende Wut und Rachegefühle zu überwinden. Aber,
so sagt sie etwa sinngemäß, wenn ich nicht das Gefühl
hätte, durch die Führungen dazu beizutragen, daß
so etwas nicht wieder vorkommt, könnte ich das nicht machen.
(Rudolf Ostermann)
Anfang
Zeitung
Menschenrechte
„im Kleinen", Kinderkarawane in Rodgau.
zurück
zum Inhalt
14. August 99: Die Kinderkarawane
in Rodgau - munaVeRo war dabei
Die „Kinderkarawane" ist eine Veranstaltung, die mal hier, mal dort stattfindet: Wie eine Karawane zieht sie durchs Land, um auf die Kinderrechte hinzuweisen.
Die UN-Kinderrechtskonvention ist vor 10 Jahren von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet worden.
Zwar hatte man damals in erster Linie
die verwahrlosten und entrechteten Kinder der dritten Welt im
Auge, aber die deklarierten Rechte der Kinder gelten - zumindest
formal - in allen 191 Staaten, die der Konvention zugestimmt haben
und dazu gehört natürlich auch in Deutschland.
Natürlich? Zwei Staaten haben der Konvention nicht zugestimmt:
das kleine Somalia und die Weltmacht USA, die Vereinigten Staaten
von Amerika.
MunaVeRo hat sich mit einem Stand an der Veranstaltung beteiligt. "Kinderrechte können nur dann verwirklicht werden, wenn die Erwachsenen sich vertragen, und das ist es, wofür der Verein sich einsetzt" - so der Bezug zum Vereinsziel. Konkret stellte der Verein die Frage, ob es in Rodgau genügend Plätze gibt, wo Kinder sich begegnen und spielen können. Auf Fotos wurden gute und weniger gelungene Beispiele aus Rodgau gezeigt.
Es war eine schöne Veranstaltung, die nur unter dem relativ schlechten Wetter zu leiden hatte.
Übrigens... wussten Sie, dass Deutschland nur formal nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Kinder ungeachtet ihrer Herkunft und Nationalität verstößt? Als Deutschland die Konvention 1992 ratifizierte, geschah dieses unter dem Vorbehalt, dass es weiterhin einschränkende ausländerrechtliche Bestimmungen erlassen kann. Das betrifft vor allem die minderjährigen Flüchtlingskinder. Infolgedessen widersprechen viele Regelungen und die Verwaltungspraxis dem Ziel der Kinderrechtskonvention:
-- viele jugendliche Flüchtlinge verfügen nur über eine Duldung, was in einigen Bundesländern zu Einschränkungen beim Schulbesuch führt
-- eine Berufsausbildung scheitert meist an der Arbeitserlaubnis, die bei Einreise nach dem 15.5.97 generell nicht mehr erteilt wird
-- wenn unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge Asyl beantragen, müssen sie das gleiche
Verfahren durchlaufen wie Erwachsene, was sie häufig überfordert.
Der UN-Kinderrechtsausschuss fordert
von Deutschland die Rücknahme der völkerrechtlich ohnehin
umstrittenen Vorbehaltsklausel und einen Verzicht auf die Inhaftierung
Jugendlicher vor der Abschiebung. (Lt. taz vom 20.8.99 sassen
allein in Berlin 1998 rund 80 Minderjährige in Abschiebehaft.)
Aber es war ein schönes Fest!
(Jean-Pierre Luyten)
Kinderleichte
Fragen, schwer zu beantworten.
Die Kinderkarawane war in Rodgau und es hat geregnet. Aber die Kinder haben sich das Fest und die Fragelust nicht verderben lassen.
Ob sie allerdings bei der Befragung der Politiker immer die rechten und durchdachten Antworten bekommen haben? Manches klang doch zu sehr nach Beschönigen und Abwiegeln bis hin zum Abbügeln.
Was soll ein armer Politiker aber auch auf unverblümt gestellte Kinder-Fragen antworten, bei denen ihm die Detailkenntnisse fehlen, oder deren Beantwortung ihm schwerfällt, weil es keine gute Antwort gibt?
Wenn auf die Frage nach längeren
Grünphasen für Überwege geantwortet wurde, das
sei ein technisches Problem und da könne man nichts machen
... Arme Technik!
Auch der Bürgermeister geriet unversehens ins Schwimmen, als er auf die Frage, warum es denn Kinderspielplätze ohne jedes Spielgerät gäbe, die Erklärung anbieten wollte, das sei wohl Absicht, damit genügend Raum für Ballspiele bleibe.
Und warum stehen da Schilder, daß Ballspielen verboten ist?
Die Zusatzfrage zwang ihm die Erkenntnis
auf, daß er sich das vor Ort wohl nochmal genauer ansehen
müsse.
Genügend Verbotsschilder waren uns bei der Sichtung von Spielplätzen und Spielmöglichkeiten leider auch aufgefallen.
Viele Spielmöglichkeiten finden noch Kinder unter 12 Jahren.
Alt-Rocker und Rockerbräute
von 13 Jahren dürfen die meisten Spielplätze leider
nicht mehr betreten. (Dort, wo sie dann hingehen, stören
sie natürlich auch!)
(Rudolf Ostermann)
munaVeRo-Wochenende
am 27./28.11.99 auf der Burg Breuberg
zurück
zum Inhalt
Schon lange reden wir davon, jetzt
ist es endlich bald soweit.
Am Samstag, den 27.11. werden wir
mit dem Verein zur Burg Breuberg fahren. Die Burg Breuberg ist
eine Jugendherberge im Odenwald. Wir werden Fahrgemeinschaften
bilden, um unnötige Fahrten und Kosten zu vermeiden.
Wir werden am Samstagvormittag fahren,
so daß wir noch vor dem Mittagessen einchecken und dann
gemeinsam zu Tisch gehen können. Den Abschluß bildet
dann wieder das gemeinsame Mittagessen am Sonntag.
Was werden wir dort machen?
Wir verfolgen zwei Ziele. Das erste
wurde in der Einladung zur Mitgliederversammlung genannt: Wir
sollten uns Gedanken machen, ob die bisherige Vereinsarbeit gut
war, was wir besser machen können und wie wir diese Ideen
umsetzen können. Das zweite Ziel ist, daß wir miteinander
ein schönes Wochenende verbringen. Die Geselligkeit, das
Gespräch außerhalb der Tagesordnung und der Spaß
miteinander sind genauso wichtig wie die Arbeit.
Übrigens, wer sich noch nicht
gemeldet hat: Bitte sofort nachmelden!
Jean-Pierre Luyten
Nach dem Krieg - Vor dem Krieg?
Bilder von brennenden Häusern, Bilder von endlosen Flüchtlingsströmen in Regen und Kälte, Bilder von zerstörten Brücken und Fabriken, die anklagenden Blicke von Müttern, die man ihrer Kinder beraubt hat, Zeltstädte im Morast, Menschen, die verzweifelt nach ihren Angehörigen suchen, Wegelagerer in Uniform, die den Fliehenden die letzten Habseligkeiten rauben - so und ähnlich haben wir den unerklärten Krieg in Erinnerung, der wochenlang tobte, keine zwei Flugstunden von uns entfernt.
Unser aufgeklärtes, tolerantes Europa hat sich hier noch einmal von einer Seite gezeigt, die wir für tot und begraben hielten.
Mit dem Untergang der Hitlers, Mussolinis, Stalins schien das Gespenst des Krieges aus Europa verbannt zu sein. 45 Jahre lang war Frieden, wenn auch jederzeit bedroht durch die gegenseitige Hochrüstung der Supermächte; aber immerhin, es war Frieden.
Jetzt schweigen also die Waffen im Kosovo. Nur - es wollen die Schreckensbilder des Krieges einfach nicht weichen. Immer noch werden Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, immer noch brennen Häuser. Und selbst die KFOR-Truppen, die jetzt im Land stehen, können nicht verhindern, daß sich das, was wir gewohnt waren zu sehen, nahtlos fortsetzt, nur unter umgekehrtem Vorzeichen: die Vertriebenen von einst sind jetzt die Vertreiber, die Brandstifter tragen andere Namen, die Plünderer, die Vergewaltiger ...
Und was lernen wir daraus? Vielleicht, daß man mit Waffengewalt zwar die Machtverhältnisse umdrehen kann, aber nicht die Herzen der Menschen.
Frieden spielt sich da ab, wo die
Menschen ihn wollen. Wo die Bereitschaft zur Verständigung
und zum Zusammenleben existiert, werden die Fanatiker aller Couleur
auf Dauer den Kürzeren ziehen. Bis dahin aber ist noch ein
weiter Weg zurückzulegen, und zwar nicht nur im Kosovo, sondern
im gesamten früheren Jugoslawien. Wer diesen Weg beschreiten
will, muß dicke Bretter bohren, muß Geduld mitbringen
und Rückschläge ertragen können. Der Weg zum schlußendlichen
Sieg des Friedens wird mit Niederlagen gepflastert sein. Die,
die ihn gehen werden, werden die wahren Helden des Kosovo sein,
Panzer und Bombenflugzeuge werden sie nicht brauchen.
Solange sich aber Albaner und Serben,
Serben und Kroaten, Kroaten und Bosnier waffenstarrend voll Angst
und Misstrauen gegenüberstehen, ist der Friede nur ein ganz
zartes Pflänzchen und wir sind vom nächsten Krieg vielleicht
nicht weiter entfernt als vom gerade vergangenen.
(Peter Konrad)
Wenn man die Geschehnisse in Ex-Jugoslawien wie ein trostloses Buch voll trauriger Kapitel verfolgt, könnte man an der Menschheit verzweifeln und jede Hoffnung auf eine positive Zukunft verlieren.
Das folgende Gedicht von Monika Luyten
erinnert uns daran, daß Menschen sich zum Glück auch
anders begegnen können, selbst, wenn sie nicht miteinander
sprechen können. (R.O.)
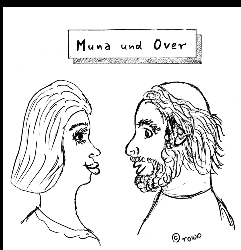
... und die Zigeuner
Over ist gerade am Badesee
vorbeigefahren, wo anscheinend mal wieder jemand vergessen hatte
die Schranke zu schließen:
Over: „ ... und stell Dir vor Muna,
schon stehen da wieder zwei Wohnwagen. Also, ich bin ja ein toleranter
Mensch, aber solchen Scheiß-Zigeunern sollte man gleich
den Marsch blasen, damit sie wieder abhauen und nicht nochmal
das ganze Gelände verk...!"
Muna: (unterbricht ihn empört) „
... sei bloß still, Du erztoleranter Menschenfreund, Du!
Weißt Du denn, ob die irgendetwas mit der Gruppe zu tun
haben, die sich damals so danebenbenommen hat?"
Over: „ Also ja, .. ich meine nö,
eigentlich nicht, ... aber es könnte ja immerhin möglich
sein, so wie die aussehen!"
Muna: „ Und wie sehen sie aus?"
Over: „Frag doch nicht so blöd,
wie eben Zigeuner aussehen! Meinst Du, ich hab die mir so genau
angesehen?"
Muna: „Aber sie sahen so aus, wie
die, die damals hier Hochzeit gefeiert haben?"
Over: „Klar doch, glaub ich jedenfalls
..."
Muna: „Hast Du mir nicht erzählt,
daß Du damals im Urlaub warst und von der Schweinerei nur
hinterher in der Zeitung gelesen hast? War das eigentlich ein
Bildbericht?"
Over: „Nö, Bilder gab's da
keine, aber was die in der Zeitung geschrieben haben, hat mir
gereicht! Die Scheiß-Zigeuner können froh sein, daß
ich gerade mit meinen Kumpels in Urlaub war, sonst hätten
die was erlebt!"
Muna: „Also, jetzt schalt aber mal deinen Verstand auf Empfang, Over! Du hast Dir die Leute jetzt nicht richtig angesehen, aber Du weißt, daß sie so aussehen, wie die, die Du überhaupt nicht gesehen hast? Was ist denn das für ein gequirlter Wellensalat!?
Und aufgrund dieser erdrückenden Indizien willst Du ihnen den Marsch blasen?
Aber noch etwas, Over,
hat nicht Dein Kumpel Theo erzählt, daß ihr bei dem
Urlaub in Südfrankreich wild gecampt habt und daß es
dort auch nur die eine ganz große Toilette gab? Was sagen
denn die Franzosen, wenn dort mal wieder deutsche Scheißer
vorbeikommen?"
Over: (hat Funkstille, ihm fällt
gerade keine Antwort ein)
Muna: „Tu mir einen Gefallen und
schau zumindest mal genau hin, bevor Du deine Vorurteile über
andere Menschen fällst! Und im übrigen bitte ich Dich
von Roma oder Sinti und Roma und nicht von Zigeunern zu sprechen.
Die meisten möchten nicht so genannt werden.!"
Over: (räuspert sich, dann grinst er etwas velegen) „Okay, ist in Ordnung, Muna, es tut mir leid.
Aber trotzdem, hoffentlich
Sinti bald weg, die Roma!"
Mitgliederversammlung am 8. September
Der Vorstand hat für Mittwoch,
den 8. September 1999 ab 19:30 Uhr
zur Mitgliederversammlung eingeladen.
Ort: ev. Gemeindehaus Nieder Roden,
am Puiseauxplatz (Eingang Lichtenbergstraße)
Tagesordnung:
1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 17.1.99
2. Mitteilungen des Vorstands
3. Diskussion über Ziele, Arbeitsweise und Wirkung des Vereins
4. Ziele und Ablauf des munaVeRo-Wochenendes am 27./28.11.99 auf der Burg
Breuberg
5. Gegenseitige Unterrichtung
Erläuterung zur Tagesordnung
Innerhalb des Vorstands wird darüber nachgedacht, wie es mit unserem Verein
weitergehen soll. Der Vorstand möchte alle Mitglieder in diese Überlegungen
einbeziehen.
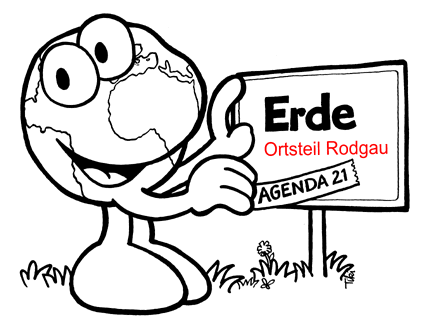 zurück zum Inhalt
zurück zum Inhalt
Lokale Agenda 21
- munaVeRo und die Agenda
Die Stadt Rodgau hatte Vereine, Firmen und Organisationen zur Beteiligung an einer Lokalen Agenda 21 aufgefordert und am 20.Mai 99 einen Informationsabend für diese Gruppen veranstaltet. Am 12. Juni waren alle Bürger zu einem ganztägigen Agenda-Workshop ins Rathaus eingeladen. In kleinen Gruppen und gemeinsam wurden wichtige Themen zur Planung und Gestaltung einer Zukunft Rodgaus unter Agenda-Gesichtspunkten diskutiert. Zu drei Themen/Themengruppen, die von der Mehrheit angesprochen worden waren, fanden sich vorläufige Arbeitsgruppen aus dem Kreis der Teilnehmer, die erste konkrete Planungsschritte und Maßnahmen erarbeiten wollen.
Eine Gruppe hat sich das Thema „Verkehrsplanung/
Beruhigung vorgenommen, eine weitere das Umweltthema „Rodaubegrünung"
(Grünes Band durch Rodgau) und die dritte das „Soziale
Zusammenleben".
MunaVeRo arbeitet in dieser letzten Gruppe mit. Gemeinsam mit Vertretern der Bürgerhilfe, des Kinderschutzbundes und privaten Vertretern haben wir uns als Ziel die Verbesserung der Begegnungsmöglichkeiten für alle Generationen und Nationen und der Möglichkeiten für Spiel und sinnvolle Freizeitgestaltung gesetzt. Nahziele sind eine Bestandsaufnahme, der Aufbau von Kontakten zu anderen Gruppen und Organisationen, die mitarbeiten könnten, oder deren Erfahrung wir nutzen sollten und natürlich auch die Einbindung und angemessene Beteiligung der betroffenen Menschen, auch der Kinder und Jugendlichen.
Um uns nicht zu verzetteln, wollen
wir uns (wegen der zufälligen mehrheitlichen Zusammensetzung
der Gruppe) für erste konkrete Maßnahmen zunächst
auf den Ortsteil Nieder Roden beschränken. Zweimal hat sich
die Gruppe bereits im August getroffen. Im September wollen wir
uns bei der Stadt über Flächennutzung und Planung für
den Ortsteil eingehender informieren und danach auch eine Begehung
durchführen. Eine Fragebogenaktion für Jugendliche ist
geplant.
- Jeder redet von der Agenda,
was ist eigentlich der Hintergrund?
Beschlossen wurde die Agenda 21 auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCED) im Juni 1992 in Rio de Janeiro. Der Begriff Agenda selbst stammt aus dem Latein, der Sprache der alten Römer und bedeutet wörtlich etwa: „Das, was getan werden muß/ Das, was zu tun ist".
Er steht also für etwas, was
man als wichtige zu erledigende Aufgabe(n) erkannt hat und sich
zu tun vornimmt.
Im Vorwort zur deutschen Übersetzung der AGENDA 21 heißt es:
„Die Agenda 21, die mit ihren 40 Kapiteln alle wesentlichen Politikbereiche einer umweltverträglichen, nachhaltigen Entwicklung anspricht, ist das in Rio von mehr als 170 Staaten verabschiedete Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert.
Mit diesem Aktionsprogramm werden detaillierte Handlungsaufträge gegeben, um einer weiteren Verschlechterung der Situation entgegenzuwirken, eine schrittweise Verbesserung zu erreichen und eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sicherzustellen. Wesentlicher Ansatz ist dabei die Integration von Umweltaspekten in alle anderen Politikbereiche. Das Aktionsprogramm gilt sowohl für Industrie- wie für Entwicklungsländer. Es enthält wichtige Festlegungen, u. a. zur Armutsbekämpfung, Bevölkerungspolitik, zu Handel und Umwelt, zur Abfall-, Chemikalien-, Klima- und Energiepolitik, zur Landwirtschaftspolitik sowie zu finanzieller und technologischer Zusammenarbeit der Industrie- und Entwicklungsländer.
Die Bundesregierung orientiert sich
bei ihrer bi- und multilateralen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit
an der Agenda 21."
Grundgedanke der Agenda ist es, den
Erhalt einer lebenswerten Zukunft für alle Menschen durch
dieses „Aktionsprogramm" gemeinsam und konsequent (nachhaltig)
anzustreben. Hierzu haben sich über 170 Staaten durch die
Unterzeichnung der 1992 erarbeiteten Agenda verpflichtet.
Nachhaltige (dauerhafte) Maßnahmen
zur Eindämmung von Umweltschäden bzw. zum Erhaltung einer unzerstörten Umwelt,
zum sparsamer Umgang mit Energie und Rohstoffen,
zu deren verstärkten Wiederverwendung,
zur Vermeidung giftiger Stoffe und unnötiger Abfälle,
aber auch Maßnahmen,
die eine Lebensgrundlage und wirtschaftliche Existenz für alle Menschen ermöglichen,
den gerechte Ausgleich zwischen den Nationen fördern
und das soziale Zusammenleben und Miteinander für alle Generationen verbessern
gehören zum Agendaprogramm.
Es sind zunächst global (weltweit) definierte Ziele, die sich die Unterzeichner-Staaten (auch Deutschland) gesetzt haben. Viele davon können aber nicht verwirklicht werden, wenn nicht überall in der Welt auf lokaler Ebene, in Städten und Gemeinden, Menschen und Organisationen die Probleme angehen, die vor Ort gelöst werden müssen. (Wichtig - gerade für die Nachhaltigkeit - ist dabei auch die Zustimmung und Beteiligung aller Bürger und Organisationen am Agendaprozess.)
Dies war den Teilnehmern der Umweltkonferenz bereits bewusst und sie haben in Kapitel 28 der Agenda21 die Notwendigkeit von kommunalen Initiativen zur Unterstützung der Agenda21 hervorgehoben (also einer Lokalen Agenda 21, wie man die Verwirklichung solcher kommunalen Initiativen heute nennt) und den Staaten als Verpflichtung auferlegt.
Daher gibt es jetzt in fast allen
Städten Lokale Agendaprogramme (die Stadt Rodgau hat damit
wie viele andere Städten sogar recht spät begonnen,
eigentlich hätte das schon 1996 stattfinden sollen) und der
überraschte Bürger sieht sich unerwartet nach seiner
Meinung und Mitwirkung gefragt, die den Planern sonst eher unerwünscht
war.
Meine Meinung:
Solange die Bereitschaft anhält
und wir Gehör finden, sollten wir die Chance nutzen. Es geht
schließlich um die Gestaltung unserer Zukunft!
zurück zum Inhalt
Kapitel 28 (Auszug, aus der deutschen Übersetzung der Agenda 21)
INITIATIVEN DER KOMMUNEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER AGENDA 21
PROGRAMMBEREICH
Handlungsgrundlage
28.1 Da viele der in der
Agenda 21 angesprochenen Probleme und Lösungen auf Aktivitäten
auf der örtlichen Ebene zurückzuführen sind, ist
die Beteiligung und Mitwirkung der Kommunen ein entscheidender
Faktor bei der Verwirklichung der in der Agenda enthaltenen Zielen.
Kommunen errichten, verwalten und unterhalten die wirtschaftliche,
soziale und ökologische Infrastruktur, überwachen den
Planungsablauf, entscheiden über die kommunale Umweltpolitik
und kommunale Umweltvorschriften und wirken außerdem an
der Umsetzung der nationalen und regionalen Umweltpolitik mit.
Als Politik- und Verwaltungsebene, die den Bürgern am nächsten
ist, spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Informierung
und Mobilisierung der Öffentlichkeit und ihrer Sensibilisierung
für eine nachhaltige umweltverträgliche Entwicklung.
Ziele
28.2 In diesem Programmbereich sind folgende Ziele vorgesehen:
a) bis 1996 soll sich die Mehrzahl der Kommunalverwaltungen der einzelnen Länder gemeinsam mit ihren Bürgern einem Konsultationsprozess unterzogen haben und einen Konsens hinsichtlich einer "kommunalen Agenda 21" für die Gemeinschaft erzielt haben;
b) ...
c) ...
d) alle Kommunen in jedem
einzelnen Land sollen dazu angehalten werden, Programme durchzuführen
und zu überwachen, deren Ziel die Beteiligung von Frauen
und Jugendlichen an Entscheidungs-, Planungs- und Umsetzungsprozessen
ist.
Maßnahmen
28.3 Jede Kommunalverwaltung
soll in einen Dialog mit ihren Bürgern, örtlichen Organisationen
und der Privatwirtschaft eintreten und eine "kommunale Agenda
21" beschließen. Durch Konsultation und Herstellung
eines Konsenses würden die Kommunen von ihren Bürgern
und von örtlichen Organisationen, von Bürger-, Gemeinde-,
Wirtschafts- und Gewerbeorganisationen lernen und für die
Formulierung der am besten geeigneten Strategien die erforderlichen
Informationen erlangen. Durch den Konsultationsprozess würde
das Bewusstsein der einzelnen Haushalte für Fragen der nachhaltigen
Entwicklung geschärft. Außerdem würden kommunalpolitische
Programme, Leitlinien, Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verwirklichung
der Ziele der Agenda 21 auf der Grundlage der verabschiedeten
kommunalen Programme bewertet und modifiziert. Strategien könnten
auch dazu herangezogen werden, Vorschläge für die Finanzierung
auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene
zu begründen.
28.4 Partnerschaften zwischen einschlägigen Organen und Organisationen wie etwa ...
sollen gefördert werden,
um vermehrt eine internationale Unterstützung für Programme
der Kommunen zu mobilisieren. Ein wichtiges Ziel in diesem Zusammenhang
wäre, bereits vorhandene Institutionen, die mit der Stärkung
der Handlungsfähigkeit der Kommunen und dem kommunalen Umweltmanagement
befasst sind, vermehrt zu fördern, auszubauen und zu verbessern.
Zu diesem Zweck ....
Fünf Jahre Jugendaustausch
mit Polen
Seit 1995 führt die Georg-Büchner-Schule
in Jügesheim zusammen mit dem Kreisjugendring und dem Kreis
Offenbach einen Schüler- und Jugendaustausch mit Ilawa (ehem.
Dt. Eylau) am Rande der Masurischen Seenplatte durch. Teilnehmer
der vielfältigen Kontakte auch zwischen den Jugendfeuerwehren
Dudenhofen und Ilawa haben inzwischen den Deutsch-Polnischen Freundschaftsverein
Rodgau gegründet, der die Begegnungen fördert und eigene
durchführt.
Nicht immer ist es leicht, genügend
interessierte Jugendliche zu finden, die bereit sind, in unser
östliches Nachbarland mitzufahren, um dort in den Familien
untergebracht zu werden. Viele negative Vorurteile prägen
unser Polenbild: Dort würde geklaut und gesoffen, man könne
sich nicht verständigen, das Land sei heruntergekommen, unterentwickelt
und uninteressant, die Leute seien unfreundlich, unehrlich und
deutschfeindlich.
Jugendliche, die dennoch den Mut
aufbringen, Polen kennen zu lernen, machen sehr interessante und
positive Erfahrungen.
Überwältigend ist die Gastfreundschaft
der Polen: In der Regel rückt die Familie eng zusammen, ein
Zimmer wird für den Gast frei gemacht und Schränke extra
leergeräumt. Es werden persönliche Opfer gebracht. Um
das Wohlergehen des Besuchers ist man sehr besorgt und jeder Wunsch
des Gastes wird erfüllt. Zu Essen gibt es sehr viel und sehr
gut, manchmal hat man den Eindruck, man wird über die Verhältnisse
der Familien umsorgt.
Uns Deutschen gegenüber ist
man sehr aufgeschlossen, man spricht uns an - in deutsch, manchmal
auch in englischer Sprache - und möchte wissen, wo wir herkommen,
was wir in Polen machen, wie wir das Land einschätzen u.s.w..
Unsere Jugendlichen wurden schon von wildfremden jungen Polen
bei solchen Gesprächen ins Bistros zu einem Getränk
eingeladen. Menschen und auch Freunde lernt man in Polen sehr
schnell kennen.
Die Landschaft um Ilawa (Dt. Eylau)
herum ist traumhaft schön: Naturbelassene Wälder und
Seen wechseln sich ab, die Städte und Dörfer werden
seit dem Zusammenbruch des Kommunismus renoviert und saniert.
Gerade Ilawa macht einen sehr gepflegten Eindruck und lädt
auch zur Erholung in den Ferien ein. Segeln und Surfen auf dem
Geserichsee, Ausflüge nach Marienburg, Allenstein, Danzig,
Thorn und an die Frische Nehrung an der Ostsee sind lohnenswerte
Urlaubsaktivitäten. Sowohl unter touristischen als auch unter
kulturellen Aspekten lohnt sich eine Reise in unser östliches
Nachbarland allemal.
Das Urteil unserer diesjährigen
Mitfahrer ist einstimmig: Polen ist ein schönes Land mit
einer sehr freundlichen und zuvorkommenden Bevölkerung. Man
kann dort sehr interessante Erfahrungen machen und dabei noch
die Reisekasse schonen. Für uns Deutsche sind die Preise
in Polen sehr niedrig.
(Mathias Lippert)
Minderheiten: Deutsche in Polen
- Polen in Deutschland:
Nachdem am 24. August 1989 der erste nicht-kommunistische polnische Regierungschef gewählt worden war, widerrief das offizielle Polen bald die Behauptung der früheren kommunistischen Regierung, daß es in Polen keine deutsche Minderheit gäbe. Nach der Demokratisierung Polens kann dieses Thema jetzt auch wissenschaftlich erforscht werden:
1993 zählten die Vereine der deutschen Minderheit in Polen fast 300.000 Mitglieder, darunter in den Bezirken Oppeln 180.000 und Kattowitz 80.000. Die polnische Regierung schätzt die Gesamtzahl der polnischen Bürger, die sich selbst als Deutsche bezeichnen, auf maximal 400.000. Seriöse Selbstschätzungen der deutschen Minderheit kommen zu einer Höchstzahl von 600.000, doch sind darunter bestimmt auch polnische Bürger mitgezählt, die sich sowohl als Deutsche als auch als Polen verstehen. Mithin gehören 1 % - 1,5 % der polnischen Bürger zur deutschen Minderheit.
Die deutsche Minderheit hat auch das Recht, politische Parteien zu bilden, bei den ersten voll-demokratischen Parlamentswahlen vom 27. Oktober 1991 erhält sie nach Verhältniswahl 7 von 460 Abgeordneten, mithin ca 1,5 %.
Die deutsche Regierung vermutet, daß sich ca 100.000 polnische Bürger deutscher Volkszugehörigkeit gemäß Artikel 116 des Grundgesetzes einen deutschen Reisepass haben ausstellen lassen.
Unter "Polonia" versteht man in Polen die "Auslandspolen", d.h. unabhängig von der Staatsbürgerschaft diejenige Personengruppe, die sich zur polnischen Sprache, Kultur oder Tradition bekennen. Weltweit umfaßt die Polonia rund 10 Millionen Menschen, darunter leben etwa zwei Drittel in den USA.
Die Erforschung der Deutschland-Polonia ist gegenwärtig noch überwiegend Zukunftsaufgabe, polnische Experten gehen hypothetisch davon aus, daß sie etwa 600.000 Menschen umfaßt. Diesen Schätzungen zu Folge wäre die polnische Minderheit in Deutschland absolut mindestens genau so groß wie die deutsche Minderheit in Polen, ihr Anteil an der Bevölkerung betrüge ca 0,8 %. (Angaben für Anfang der 90er Jahre) Wissenschaftlich unbrauchbar sind hierzu die offiziellen deutschen Statistiken, diese weisen lediglich polnische Bürger ohne Doppelstaatler aus, sie belief sich Ende 1997 auf ca 283.000. Auf jeden polnischen Bürger kommt obigen Schätzungen zu Folge mindestens noch ein deutscher Bürger, der sich selbst als Pole bezeichnet.
Sowohl das demokratische Deutschland als auch das demokratische Polen haben also ethnische Minderheiten aus dem jeweils anderen Staat. Ist es nicht bemerkenswert, daß die junge polnische Demokratie seiner deutschen Minderheit sogar eine Parlamentsvertretung zugesteht?
(Wolfgang Schürer)
Herausgeber und verantwortlich:
Vorstand des Vereins für multinationale
Verständigung Rodgau e.V.,
Wiesbadener Straße 83, 63110 Rodgau.
Tel: (06106) 733325, Fax: 886560
email: vorstand@munavero.de oder wie bisher:
munavero@t-online.de
Redaktionsleitung und ViSdP: Jean-Pierre
Luyten,
Am Flachsberg 56, 63110 Rodgau, Tel/Fax: (06106) 827163
email: redaktion@munavero.de
Redaktionsteam dieser Ausgabe:
PeterKonrad, Jean-Pierre Luyten,
Rudolf Ostermann, Wolfgang Schürer.
Sowie : Katerina Nomenestomen, genannt Muna und Oliver Nomennescio,
genannt Over.
Gastbeitrag: Mathias Lippert, Georg Büchner Schule